„Von keinem Nutzen ist die Todesstrafe, da sie den Menschen ein Grausamkeitsbeispiel gibt.“ Cesare Beccaria
Nach ersten ‚wilden’ Euthanasieversuchen durch Medikamente und Spritzen wurde die so genannte ‚Aktion T4’ institutionell geordnet. In eine Villa in der Tiergartenstraße 4 in Berlin, daher auch die Abkürzung ‚T4’, zog die Bürozentrale für die großflächig angelegten Krankenmorde ein.

Die Begrifflichkeit von ‚T4’ war eher inoffiziell, denn die NS-Begrifflichkeit bezeichnete ihre Aktionen mit den Worten ‚Euthanasie’ oder ‚Aktion Gnadentod’. Jede Pflegeanstalt, jede psychiatrische Anstalt, später auch private Sanatorien und Altenheime, bekamen Listen zugesandt, in denen sie ihre Patienten nach Krankheitsgrad aufzulisten hatten. Die Listen mussten von den Anstaltsärzten erstellt werden, doch nicht nur die Diagnose, ob heilbar, zum Teil heilbar oder unheilbar, war entscheidend, ein weiterer Punkt wurde noch mit aufgelistet, ob der Behinderte zu leichten Arbeiten herangezogen werden kann. Im Laufe der Zeit, vor allem im immer längeren Kriegsgeschehen, war die ‚Brauchbarkeit’ eines Menschen weitaus entscheidender, als sein Krankheitsbild. Der Gedanke, ‚unnütze Esser’ zu eliminieren trat immer mehr in den Vordergrund. Die Listen der Anstalten kamen dann in die Zentrale zurück und wurden dahingehend bearbeitet, dass Karteikarten von Kranken erstellt wurden, die der Vergasung zu geführt werden sollten, doch bevor diese Karteikarten erstellt werden konnten, wurden die Listen gebündelt und einem der ärztlichen Gutachter im Land zugesandt. Dieser ‚überprüfte’ die Diagnose der Anstaltsärzte, meistens ging er mit ihnen konform, doch waren die Gutachter angehalten, in Hinsicht auf die Arbeitsfähigkeit rigider vorzugehen. Die Gutachter wurden äußert gut bezahlt für diese Schreibtischtätigkeit, denn Patienten nahmen sie nicht in Augenschein. Dann gingen die mit Unterschrift des Gutachters versehenden Unterlagen zurück in die Zentrale und aus den Listen wurden dann die Karteikarten. Diese Karteikarten kamen dann in eine andere Abteilung, in der Beileidsschreiben an die Angehörigen verfasst wurden, wobei es drei verschiedene Gründe des ‚plötzlichen Verlustes’ gab: Lungenentzündung, Organausfall oder Herzversagen. Jedes Beileidsschreiben wurde persönlich verfasst. Die Karteikarten mit den Beileidsschreiben kamen dann in eine andere Abteilung, in der wurden dann wieder Listen erstellt, eine dieser Listen gingen an das Transportunternehmen, die dann die Behinderten abholten, eine weitere ging an die entsprechende Anstalt, damit diese ihre Kranken auf den Abtransport vorbereiten konnten. Die abzuholenden Gruppen von Kranken umfassten meistens 10-20 Personen, das hauseigene Personal durfte die Kranken nicht begleiten, in den Bussen fuhren begleitende Krankenschwestern, beziehungsweise Pfleger mit, ob diese immer für ihre Aufgabe ausgebildet waren, nun das war recht unterschiedlich und veränderte sich kriegsbedingt eher zum Schlechteren. Der zurückbleibenden Anstalt wurden Formblätter überreicht, die sie auszufüllen hatten, um den entsprechenden Angehörigen oder dem gesetzlichen Vormund die Verlegung des Patienten mitzuteilen. Denn die Gruppen kamen nicht gleich in die Tötungsanstalten, sie kamen zuerst in eine so genannte Zwischenstation, eine Anstalt, die sich in näherer Umgebung der Tötungsanstalt befand. Dort wurden die Patienten aufgenommen und mussten warten, bis ihr Weitertransport genehmigt war. Mehrere Gründe gab es für diese Zwischenstationen, zum einen waren die Orte des Mordens weitaus sicherer vor Angehörigenbesuchen beziehungsweise Nachfragen, zum anderen, hatten die Tötungsanstalten ‚nur’ eine Gaskammer und höchstens zwei Krematorien, so dass ihre Kapazität des Mordens mehr als begrenzt waren.

Die Wartezeit der Patienten in den ‚Zwischenanstalten’ konnten bis zu einem Monat dauern. Deren Versorgungs- und Pflegesituation waren dort katastrophal. Eine Verelendung begann bereits, als dann die Patientengruppen, nun war die Stärke der Gruppen zwischen 35 und 50 Personen, wieder in einem der ‚grauen Busse’ zu den entsprechen Tötungsstationen gefahren wurden. Meistens noch in den Bussen, manchmal auch erst nach der Ankunft, bekamen die Patienten starke Beruhigungsspritzen, diese wurden als ‚Schutzimpfung’ für die Patienten getarnt. Die so ruhig gestellten Patienten wurden dann in einen Raum geführt, manche schon auf Tragen, entkleidet und anhand der Transportliste von einem Arzt ‚begutachtet’. Danach wurde ihnen eine Nummer, die der entsprechenden Karteikarte, auf den Rücken geschrieben und sie wurden dann meistens noch fotografiert. Danach brachten die Krankenschwestern und Pfleger der Tötungsanstalt die Behinderten in die Gaskammer, die als Dusche getarnt war, die Tür wurde verriegelt und ein Arzt betätigte den Gashebel. Die Vergasung durfte laut Anordnung aus Berlin nur ein Arzt vornehmen, jeder dieser Mord-Ärzte tat seinen Dienst freiwillig und ohne Zwang. Ärzten, die sich an solchen ‚Aktionen’ nicht beteiligen wollten, erwarteten keinerlei Repressalien, wie wenige Beispiele zeigen. Den durch Gas ermordeten Menschen wurden, falls ein entsprechendes Zeichen auf dem Rücken war, Goldzähne heraus gebrochen. Dann wurden die Leichen verbrannt, die Asche wurde in Urnen verteilt und diese Urnen wurden dann mit den lange zuvor geschriebenen Beileidschreiben an die Angehörigen geschickt.
Nun verwunderte die Angehörigen, dass der Verstorbene in einer völlig anderen ‚Anstalt’ verstorben sei, als in die, in die er zuvor verlegt wurde. Allen Geheimhaltungserlassen und Verschleierungen zum Trotz, kam es zu immer mehr Nachfragen von Angehörigen. Auch Mitarbeiter in den örtlichen Amtsgerichten wurden stutzig, wenn ein Beamter, der als Vormund für mehrere Patienten fungierte, eine rechte Anhäufung von Todesfällen zugesandt bekam. Die ersten Menschen im Umfeld der Massen-Euthanasie wurden misstrauisch. Eine Tochter des Apothekers aus der Nähe von Grafeneck berichtete:
„Eine junge Frau kam, ihr Bruder hatte ihr aus einer Anstalt geschrieben, dass er wegkomme mit unbekanntem Ziel. Diesen Brief habe ich gelesen, er war klar gehalten. Dieses Fräulein hatte dann erfahren, dass ihr Bruder in Grafeneck sei und war gekommen, um ihn zu besuchen. Trotz mehrmaliger Versuche nach Grafeneck zu gelangen, wurde sie abgewiesen. Ich telefonierte dann für sie nach Grafeneck und dann wurde ihr am Polizeihäuschen noch am selben Tag ein Schreiben ausgehändigt, dass ihr Bruder an Blinddarmentzündung gestorben sei. Sie erlitt bei mir einen Nervenzusammenbruch. Denn der Blinddarm ihres Bruders war schon entfernt worden, als er 12 Jahre alt war.“

Die Nachfragen häuften sich, Stimmen wurden lauter, die protestierten; die Tarnung und Geheimhaltung bekam Brüche.
Nach interner T4-Zählung sind in den ersten sechs Monaten 8765 Menschen vergast worden, als sich dann im Juli 1940 der Widerstand verstärkte. Noch war er vage, doch vor allem aus der Justiz kam Widerstand, da es keinerlei Gesetzesvorlage gab, die das mörderische Handeln der Beteiligten rechtfertigte. Auch die Evangelische Kirche verfasste die ersten Protestbriefe, zwar noch zögerlich, doch sprach sich das Thema von Gemeinde zu Gemeinde herum. Die ersten Angehörigen schrieben Leserbriefe in Zeitungen.
Dies führte dazu, dass das Euthanasieprogramm an Intensität vermindert wurde, doch das Gesamtziel wurde dabei nicht aus den Augen verloren. Man ‚gönnte’ der öffentlichen Meinung eine Ruhepause, in dieser wurde zwar weiter gemordet, doch arbeiteten die Gaskammern im Land nur ein bis zweimal die Woche, bis zur nächsten größeren ‚Aktion T4’.
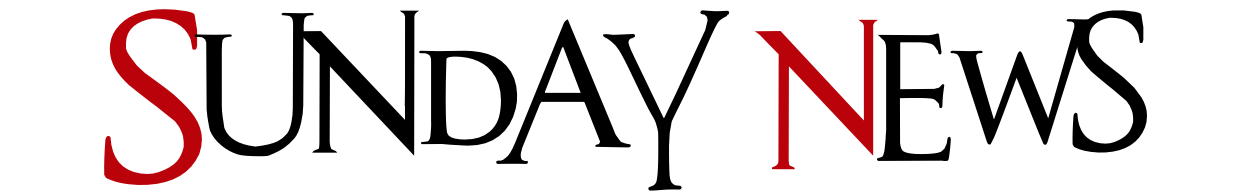

Hinterlasse einen Kommentar